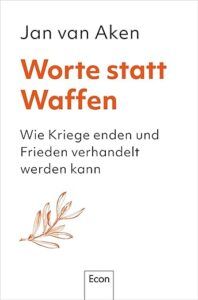
Worte statt Waffen von Jan van Aken ist ein klug aufgebautes, eindringlich geschriebenes Sachbuch über die Möglichkeiten von Diplomatie und die Grenzen militärischer Logik. Der Autor, selbst ehemaliger UN-Biowaffeninspekteur und Bundestagsabgeordneter der Partei Die Linke, verbindet persönliche Erfahrung mit analytischem Blick und fragt, wie Frieden tatsächlich verhandelt wird – und warum er so oft scheitert. Van Aken schreibt klar, unaufgeregt und zugleich engagiert. Das Buch ist keine pazifistische Predigt, sondern eine politische Analyse, die zeigt, dass Friedenspolitik konkrete Arbeit bedeutet: reden, zuhören, Kompromisse finden.
Der lange Weg zum Frieden
Jan van Aken beginnt mit einer einfachen, aber drängenden Frage: Warum hört Krieg nie auf? Er zeigt, dass Frieden kein natürlicher Zustand ist, sondern Ergebnis mühsamer Aushandlung. Van Aken beschreibt, wie Kriege enden – fast nie durch totale Siege, sondern durch Verhandlungen, Kompromisse, mühsam aufgebautes Vertrauen. Er stützt sich auf historische Fälle wie Nordirland, Bosnien oder Kolumbien und macht deutlich, dass selbst nach Waffenstillständen die eigentliche Arbeit erst beginnt.
Diplomatie statt Gewaltlogik
Ein zentrales Thema des Buches ist die Macht der Worte gegenüber der Logik der Waffen. Van Aken beschreibt, wie Sprache, Gespräche und diplomatische Gesten den entscheidenden Unterschied machen können – und wie schwer es ist, sie gegen das Denken in militärischen Kategorien durchzusetzen. Er schildert, wie Friedensprozesse daran scheitern, dass politische Akteure ihr Gegenüber nicht mehr als Partner wahrnehmen, sondern als Feind. Diplomatie, so Van Aken, beginnt dort, wo die Bereitschaft entsteht, das Gegenüber überhaupt wieder zu hören.
Der Krieg als System
Van Aken argumentiert, dass Kriege selten zufällig entstehen. Sie sind das Ergebnis ökonomischer Interessen, geopolitischer Machtverhältnisse und gesellschaftlicher Ideologien. Der Autor analysiert, wie sich militärische Logik in politische Institutionen einschreibt – und warum es so schwer ist, daraus auszubrechen. Er beschreibt, wie Staaten Kriegsfähigkeit als Grundlage ihrer Souveränität begreifen und wie sich diese Haltung selbst in Zeiten des Friedens fortsetzt.
Friedenspolitik als praktische Aufgabe
Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Friedenspolitik konkret aussehen kann. Van Aken beschreibt diplomatische Strategien, erfolgreiche Vermittlungsversuche und das notwendige Zusammenspiel von Politik, Zivilgesellschaft und internationalen Organisationen. Er betont, dass Frieden nicht nur durch Verträge entsteht, sondern durch Vertrauen – und dass dieses Vertrauen politisch geschaffen werden muss. Er fordert, Friedenspolitik nicht als moralische, sondern als strategische Notwendigkeit zu verstehen.
Der Preis des Friedens
Van Aken spart die Ambivalenzen nicht aus: Frieden hat seinen Preis. Er verlangt Zugeständnisse, Kompromisse, manchmal auch das Akzeptieren unvollkommener Lösungen. Der Autor zeigt, dass das Streben nach Gerechtigkeit und das Streben nach Frieden sich nicht immer decken. Trotzdem bleibt er dabei: Ohne den Mut zum Gespräch gibt es keine dauerhafte Lösung.
Lehren aus der Geschichte
Anhand zahlreicher Beispiele – von den Vereinten Nationen über die OSZE bis hin zu lokalen Friedensinitiativen – zeigt Van Aken, wie Friedensprozesse gestaltet werden können. Dabei wird deutlich: Es gibt keine Patentrezepte, aber Muster des Gelingens. Geduld, Einbindung, Transparenz und die Bereitschaft, Konfliktursachen statt Symptome zu bekämpfen, ziehen sich als roter Faden durch das Buch.