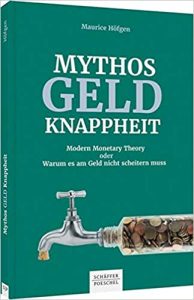
Mythos Geldknappheit ist ein Buch, das jeder Linke gelesen haben sollte. Maurice Höfgen rüttelt an einem der festesten Glaubenssätze der deutschen Politik: dass der Staat nur ausgeben darf, was er „hat“. Dass Geld ein knappes Gut sei. Dass Schulden immer böse und Sparen immer gut sei.
Er sagt: alles falsch. Und er erklärt, warum.
Der Mythos der Knappheit
Geld ist kein Ding, das man hat oder nicht hat. Es ist ein Versprechen, geschaffen aus politischem Willen. Höfgen zeigt, dass Knappheit in der Währung keine Naturkonstante, sondern ein Narrativ ist – ein Werkzeug, um Macht zu sichern und Veränderung zu verhindern. Nicht das Geld ist knapp, sondern unser Mut, es sinnvoll einzusetzen.
Wie Geld entsteht
Das meiste Geld entsteht nicht in der Schatzkammer, sondern durch Buchung: Eine Zahl in der Bilanz der Zentralbank, eine Überweisung vom Staat – schon ist neues Geld da. Es geht nicht darum, zuerst einzunehmen und dann auszugeben, sondern umgekehrt. Steuern löschen Geld, sie schaffen kein neues. Das klingt banal, ist aber revolutionär.
Der Irrtum der Schuldenbremse
Die Schuldenbremse ist das Symbol deutscher Finanzreligion. Sie zwingt Politik, Zukunftsaufgaben zu verschieben, um Gegenwartsängste zu besänftigen. Höfgen zerlegt sie mit chirurgischer Präzision: Eine Regierung, die ihre eigene Währung nutzt, kann sich nicht „verschulden“ wie ein Haushalt. Sie kann nur zu wenig investieren.
Inflation und reale Grenzen
Inflation entsteht nicht, weil der Staat Geld „druckt“, sondern wenn reale Kapazitäten überlastet sind: zu wenig Arbeiter, zu wenig Material, zu viele Engpässe. Höfgen kehrt die Perspektive um: Nicht zu viel Geld ist das Problem, sondern zu wenig produktive Struktur. Also: Investieren, bevor’s knapp wird – nicht sparen, bis alles stillsteht.
Der Staat als Arbeitgeber letzter Instanz
Arbeit gibt es genug, sie wird nur falsch verteilt. Höfgen schlägt eine Jobgarantie vor: Wer arbeiten will, soll können – im öffentlichen Sektor, im sozialen, ökologischen, kulturellen Bereich. Der Staat als Arbeitgeber der letzten Instanz beendet unfreiwillige Arbeitslosigkeit. Ein radikaler Gedanke, der alte Dogmen kippt: Arbeit ist keine Belohnung, sondern Teilhabe.
Steuern, aber richtig
Steuern sind kein Spardruck, sondern ein Lenkungsinstrument. Sie schaffen Raum für reale Werte, nicht für Zahlen auf Konten. Höfgen argumentiert: Wenn Reiche weniger konsumieren, entsteht kein Schaden – aber wenn der Staat nicht investiert, verarmen alle. Steuern werden damit zu einem politischen Werkzeug, nicht zu einem moralischen Maßstab.
Banken, Zentralbanken, Demokratie
Zentralbanken sind nicht neutral, sie sind politisch. Ihre Unabhängigkeit schützt nicht die Demokratie, sondern oft die Finanzmärkte. Höfgen fordert, das Mandat der Geldpolitik neu zu denken: Nicht Preisstabilität um jeden Preis, sondern Stabilität des Lebens. Wenn die Geldpolitik sich der Gesellschaft entfremdet, verliert sie ihren Sinn.
Der Euro als Fessel und Chance
In der Eurozone ist die Lage komplizierter. Staaten sind Nutzer, nicht Schöpfer ihrer Währung. Doch auch hier zeigt Höfgen: Es ginge anders. Gemeinsame Fiskalpolitik, koordinierte Investitionen, ein Ende der Austerität. Der Euro ist kein Naturgesetz, sondern ein politisches Projekt – und Politik kann man ändern.
Geldpolitik für das 21. Jahrhundert
Höfgen schließt mit einem Bild: Geld ist keine Bremse, sondern ein Werkzeug. Es kann zerstören, wenn man es falsch einsetzt, oder gestalten, wenn man den Mut hat. MMT – die Modern Monetary Theory – liefert dafür den theoretischen Rahmen. Keine Zauberformel, aber ein Perspektivwechsel: vom Rechnen zum Handeln.